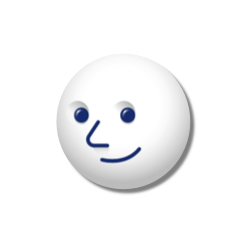Erste Orientierung
-
Hier finden Sie Antworten auf wichtige erste Fragen und eine erste Orientierung, wie es weitergeht.
- Was ist Lungenkrebs?
- Was bedeutet die Diagnose für mich?
- Wie kann Lungenkrebs behandelt werden?
- Wer kann mir helfen, mit meiner Situation zurechtzukommen?
Die Website „Hilfe für mich“ bietet Ihnen Antworten auf Ihre Fragen rund um das Leben mit Ihrer Erkrankung.
Suchen Sie in den einzelnen Kategorien oder mithilfe der Suchfunktion gezielt nach Stichwörtern.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 09.01.20
Lungenkrebs
-
Lungenkrebs, auch Lungenkarzinom oder Bronchialkarzinom genannt, gehört in Deutschland zu den häufigsten Krebsarten. Mehr als 50 000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich daran. Das durchschnittliche Erkrankungsalter bei Frauen ist 69 Jahre, bei Männern 70. Es ist aber nicht so, dass Lungenkrebs nur ältere Menschen betrifft. Manche sind bei der Erstdiagnose unter 50.
Lungenkrebs kann in allen Teilen der Lunge entstehen. Mehr als die Hälfte der Tumoren entwickelt sich in den oberen Bereichen der Lungenflügel.
Im frühen Krankheitsstadium kann Lungenkrebs in vielen Fällen gut behandelt und geheilt werden. Weil die Krankheit im frühen Stadium aber in der Regel keine Symptome verursacht, wird sie bei den meisten Betroffenen erst später entdeckt, wenn der Tumor sich ausgebreitet hat und/oder wenn Absiedlungen (Metastasen) des Tumors außerhalb der Lunge entstanden sind. Bei Diagnosestellung sind mehr als die Hälfte aller Lungentumore bereits metastasiert, und somit ist keine Heilung mehr möglich. In diesen Fällen verfolgt die Therapie das Ziel, ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden und die Lebensqualität der Patienten zu stabilisieren, zu erhalten oder zu verbessern.
Wichtig ist, dass der vorhandene Tumor möglichst genau untersucht wird. Die Diagnostik ist der Schlüssel zum Behandlungserfolg.
In der Lunge können auch Weichteilsarkome und Metastasen anderer Krebsarten auftreten. Diese sind keine Bronchialkarzinome und müssen deshalb anders behandelt werden als ein Lungentumor.
Wenn Sie mehr wissen möchten über Lungenkrebs, empfehlen wir Ihnen als Informationsquellen den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums, die Deutsche Krebsgesellschaft und den Blauen Ratgeber Lungenkrebs der Deutschen Krebshilfe.
Für Interessierte gibt es zum "1x1 der Erkrankung" auch einen Podcast.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 04.07.24 -
Krebserkrankungen entstehen durch Veränderungen im Erbgut von Zellen. Diese können bewirken, dass gesunde Zellen zu Tumorzellen werden, die unkontrolliert wachsen. So können bösartige Tumore entstehen, die andere Zellen verdrängen oder durchsetzen und dadurch gesundes Gewebe schädigen.
Die moderne Medizin geht davon aus, dass verschiedene Faktoren an der Entstehung von Lungenkrebs beteiligt sein können. Der mit Abstand größte Risikofaktor ist das Rauchen und für fast 9 von 10 Lungenkrebstodesfällen verantwortlich. Lungenkrebs kann aber auch Nicht-Raucher:innen treffen. So kommt eine US-amerikanische Studie zu dem Ergebnis, dass 10 Prozent der untersuchten Lungenkrebspatient:innen niemals geraucht haben.
Außerdem können Luftschadstoffe aus Industrie und Verkehr, Asbest, ionisierende Strahlung und möglicherweise auch manche Infektionen zu Lungenkrebs führen.
Weitere Informationen zur Entstehung von Krebs bietet die Deutsche Krebsgesellschaft.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23 -
Der Begriff „Tumor“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Anschwellung“ bzw. „Geschwulst“.
Gutartige („benigne“) Tumore sind Tumore, die beim Wachsen das umliegende Gewebe und sogar ganze Organe verdrängen, aber nicht direkt hineinwachsen. Außerdem bilden gutartige Tumore in der Regel keine Metastasen.
Bösartige („maligne“) Tumore können in gesundes Gewebe und Organe hineinwachsen und sie dadurch direkt schädigen und in ihrer Funktion beeinträchtigen. Außerdem können bösartige Tumoren Absiedlungen (sogenannte „Metastasen“) in anderen Bereichen des Körpers bilden.
Tumore in der Lunge sind zumeist bösartig. Gutartige Lungentumore kommen dagegen nur selten vor.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Tumortypen bietet die Webseite der Bayrischen Krebsgesellschaft.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 05.06.23 -
Verschiedene Faktoren können das Erkrankungsrisiko für Lungenkrebs erhöhen. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass man nicht immer einen bestimmten Grund für die Erkrankung finden kann. Lungenkrebs kann auch entstehen, ohne dass einer der bekannten Risikofaktoren vorliegt. Auch Menschen, die nie in ihrem Leben geraucht haben, können an Lungenkrebs erkranken.
Folgende Faktoren gelten als Risikofaktoren für Lungenkrebs:
Radon
Das radioaktive Edelgas Radon kann Zellen schädigen und die Entstehung von Lungenkrebs verursachen. Das unsichtbare und geruchlose Gas gelangt aus dem Boden in die Atmosphäre und kann sich in Gebäuden in der Atemluft anreichern. Da Radon schwerer als Luft ist, reichert es sich insbesondere in Kellern und Bodennähe an. Über die regionale Verteilung in der Bodenluft kann man sich auf der Radonkarte des Bundesamts für Strahlenschutz informieren.
Schadstoffe in der Atemluft/ Feinstaub
Viele Schadstoffe können, wenn sie eingeatmet werden, Lungenkrebs auslösen, z. B. Asbest, Arsen, Cadmium, Chromate, Nickel, Siliziumdioxid, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) u.v.a. Auch Feinstaub kann Lungenkrebs verursachen. Feinstaub ist ein Gemisch aus verschiedenen winzigen Partikeln in der Luft. Je kleiner die Partikel sind, desto gefährlicher sind sie für die Gesundheit, denn sie können in die Lungenbläschen eindringen, Zellschäden verursachen und Krebs auslösen.
Asbest
Langjährig in der asbestverarbeitenden Industrie Beschäftigte haben neben einer höheren Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Pleuramesothelioms (einem bösartigen, vom Rippenfell ausgehenden Tumor) auch ein deutlich erhöhtes Risiko für Lungenkrebs. Wenn der begründete Verdacht besteht, dass es sich um eine Berufskrankheit handeln könnte, muss der behandelnde Arzt/die Ärztin dies der zuständigen Berufsgenossenschaft melden. Weitere Informationen zu Berufskrankheiten finden Sie in der Rubrik „Beruf & Soziales“.
Tabakkonsum
Der mit großem Abstand wichtigste Risikofaktor für Lungenkrebs ist Tabakkonsum. Das Erkrankungsrisiko ist besonders hoch bei Rauchern, die
- schon in ihrer Jugend angefangen haben zu rauchen,
- seit vielen Jahren rauchen sowie
- jeden Tag rauchen.
Anders als viele Menschen vermuten, gleicht sich das Risiko für Lungenkrebs bei Ex-Rauchern auch nach einem langem Rauchverzicht niemals dem eines Nichtrauchers an. Dennoch zeigen Studien, dass das Erkrankungsrisiko mit jedem Jahr Nichtrauchen weiter sinkt.
Der Dampf von E-Zigaretten ist möglicherweise weniger schädlich als Tabakrauch. Jedoch gibt es bisher zu wenig Daten, um das Langzeitrisiko von E-Zigaretten zweifelsfrei einschätzen zu können.
Mögliche weitere Risikofaktoren
Einige Studien deuten darauf hin, dass manche virale Erkrankungen (z. B. Infektion mit dem Humanen Papillomavirus HPV und HIV-Infektion) das Lungenkrebsrisiko erhöhen können.
Weitere Informationen zu den Risikofaktoren für Lungenkrebs bieten der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums und die Deutsche Krebsgesellschaft.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23 -
Rauchen ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Lungenerkrankungen. Durch einen Rauchstopp können Raucher ihr Erkrankungsrisiko für Lungenkrebs und viele andere Krebserkrankungen deutlich reduzieren – je früher, desto besser.
Ein Rauchstopp lohnt sich aber auch für Menschen, die bereits an Lungenkrebs erkrankt sind. Eine Studie der Universität Birmingham hat gezeigt, dass Menschen in einem frühen Lungenkrebsstadium ihre Überlebenswahrscheinlichkeit (bezogen auf einen Zeitraum von 5 Jahren) verdoppeln, wenn sie mit dem Rauchen aufhören.
Weitere Informationen und Hilfestellungen für die Tabakentwöhnung bietet die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP).
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 19.01.22 -
Grundsätzlich unterteilt man Lungentumore in zwei Arten, die unterschiedlich behandelt werden:
- kleinzelliger Lungenkrebs (englisch: small cell lung cancer, SCLC) – rund 20 % der Fälle
- nichtkleinzelliger Lungenkrebs (englisch: non small cell lung cancer, NSCLC) – rund 80 % der Fälle
Bei den nichtkleinzelligen Tumoren unterscheidet man histologische Untergruppen, z. B. Plattenepithelkarzinome, Adenokarzinome und großzellige Karzinome.
Durch molekularbiologische Untersuchungen lassen sich diese Untergruppen in Subtypen unterteilen. Diese unterscheiden sich z. B. im Hinblick auf genetische Merkmale , die wiederum Konsequenzen für die Therapie haben können. Die Krebsforschung setzt darauf, durch immer genauere Untersuchungen weitere Subtypen zu identifizieren, um zusätzliche gezielte Behandlungsmöglichkeiten entwickeln zu können.
Weitere Informationen finden Sie beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums und im Blauen Ratgeber Lungenkrebs der Deutschen Krebshilfe.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23 -
Durch eine feingewebliche Untersuchung unter dem Mikroskop kann man feststellen, ob es sich um kleinzelligen oder nichtkleinzelligen Lungenkrebs handelt:
- Kleinzellige Lungentumore sind im Allgemeinen besonders aggressiv. Sie wachsen schnell und metastasieren früh. Kleinzellige Lungentumore werden in frühen Krankheitsstadienin der Regel mit Chemotherapie, häufig in Kombination mit Strahlentherapie (sogenannte Radiochemotherapie) behandelt. Eine vollständige Entfernung durch Operation ist selten möglich, da diese Tumore aufgrund ihres beschriebenen biologischen Verhaltens häufig kleinste Metastasen ausbilden, die nur mittels Chemotherapie behandelt werden können. Wenn Fernmetastasen vorhanden sind, wird häufig eine Chemotherapie in Kombination mit Immuntherapie durchgeführt. Weitere Therapiemöglichkeiten befinden sich in der Entwicklung und sind im Rahmen von klinischen Studien verfügbar.
- Nichtkleinzellige Lungentumore werden im frühen Stadium meist operiert. Stadienabhängig kann vor oder nach der Therapie eine Chemotherapie oder ggf. eine Immuntherapie in Frage kommen. Sollten der Allgemeinzustand oder Begleiterkrankungen eine Operation nicht zulassen, kann im Frühstadium eine zielgerichtete Strahlentherapie zum Einsatz kommen, in späteren Stadien eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie. Im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf werden meist medikamentöse Therapien eingesetzt (z. B. zielgerichtete Therapien, personalisierte Medizin, Immuntherapie).
Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik „Behandlung“.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23 - Kleinzellige Lungentumore sind im Allgemeinen besonders aggressiv. Sie wachsen schnell und metastasieren früh. Kleinzellige Lungentumore werden in frühen Krankheitsstadienin der Regel mit Chemotherapie, häufig in Kombination mit Strahlentherapie (sogenannte Radiochemotherapie) behandelt. Eine vollständige Entfernung durch Operation ist selten möglich, da diese Tumore aufgrund ihres beschriebenen biologischen Verhaltens häufig kleinste Metastasen ausbilden, die nur mittels Chemotherapie behandelt werden können. Wenn Fernmetastasen vorhanden sind, wird häufig eine Chemotherapie in Kombination mit Immuntherapie durchgeführt. Weitere Therapiemöglichkeiten befinden sich in der Entwicklung und sind im Rahmen von klinischen Studien verfügbar.
Symptome
-
Folgende Beschwerden können auf Lungenkrebs hindeuten:
- Wochenlang anhaltender Husten oder chronischer Raucherhusten, der sich plötzlich verschlimmert
- Blutiger Auswurf beim Husten, auch in Verbindung mit Fieberschüben und Erschöpfung
- Hartnäckige Bronchitis, die sich trotz Behandlung mit Antibiotika nicht bessert
- Heiserkeit und Schluckbeschwerden
- Atemnot, pfeifende Atemgeräusche
- Schmerzen im Brustkorb
- Rückenschmerzen im oberen Rückenbereich
- Lähmungen und starke Schmerzen
- Allgemeiner Kräfteverfall
- Nachtschweiß
- Starker Gewichtsverlust
Im frühen Stadium der Erkrankung verursacht Lungenkrebs selten Beschwerden. Deshalb werden kleinere Tumore in der Regel zufällig entdeckt, beispielsweise bei Röntgenuntersuchungen des Brustkorbs, die aus einem anderen Anlass durchgeführt werden.
Viele Beschwerden, die durch Lungenkrebs verursacht werden, können auch durch andere Erkrankungen der Atemwege hervorgerufen werden. Deshalb kommt es häufig vor, dass Lungenkrebssymptome beispielsweise als schwere Bronchitis fehldiagnostiziert werden.
Weitere Informationen finden Sie beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums und im Blauen Ratgeber Lungenkrebs der Deutschen Krebshilfe.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 01.09.20 -
Im fortgeschrittenen Stadium können in verschiedenen Bereichen des Körpers Tochtergeschwülste, sogenannte „Metastasen“, entstehen. Betroffen sind häufig Leber, Nebennieren, Knochen und Gehirn. Folgende Beschwerden können auf eine Metastasierung hindeuten:
- Schmerzen in den Knochen
- Schmerzen im Oberbauch, Gewichtsverlust, Erschöpfung, Müdigkeit
- Kopfschmerzen und neurologische Störungen (z. B. Verwirrtheit, Lähmungen, Krampfanfälle)
Weitere Informationen finden Sie beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums und im Blauen Ratgeber Lungenkrebs der Deutschen Krebshilfe.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 01.09.20 -
Es gibt viele Erkrankungen, die einen Husten auslösen können. Bei einem hartnäckigen Husten, der länger als ein paar Tage andauert, sollten Sie deshalb einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache festgestellt wird und der Husten behandelt werden kann.
Wenn neben dem Husten andere Symptome wie Gewichtsverlust, Erschöpfung oder blutiger Auswurf hinzukommen, sollten Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin darauf hinweisen. Raucher sollten diese Symptome besonders ernst nehmen, da bei ihnen das Lungenkrebsrisiko überdurchschnittlich hoch ist.
Für langjährige starke Raucher:innen bzw. Ex-Raucher:innen wird es in naher Zukunft möglicherweise ein Screening mittels Computertomografie geben. Entsprechende Diagnoseverfahren zur Lungenkrebs-Früherkennung befinden sich in der Entwicklung, werden derzeit aber noch nicht angeboten (Stand: Dezember 2023).
Weitere Informationen finden Sie beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums und im Blauen Ratgeber Lungenkrebs der Deutschen Krebshilfe.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23
Perspektive
-
Der Verlauf und die Erfolgsaussichten einer Therapie unterscheiden sich von Fall zu Fall, denn sie hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab.
Wichtig für die weitere Behandlung ist z. B. die Frage, um welche Tumorart es sich handelt (kleinzelliger oder nichtkleinzelliger Lungenkrebs) und wie weit die Krankheit bereits fortgeschritten ist.
Weitere Faktoren, die für die Behandlung eine Rolle spielen können, sind Genmutationen im Tumorgewebe, das Geschlecht der betroffenen Person, der allgemeine Gesundheitszustand und bereits vorhandene, andere Erkrankungen bzw. Vorerkrankungen. Frauen scheinen besser auf die Therapie anzusprechen, während Patienten/Patientinnen mit starkem Gewichtsverlust eine schlechte Prognose haben.
Grundsätzlich gilt beim Lungenkrebs, dass eine Heilung im frühen Krankheitsstadium, wenn noch keine Metastasen vorhanden sind, in vielen Fällen möglich ist. Darunter fallen Tumore, die entweder nur in der Lunge lokalisiert sind oder sich in begrenztem Umfang in die umgebenden Lymphknoten ausgebreitet haben.
Im fortgeschrittenen Stadium ist eine Heilung hingegen meist nicht mehr möglich. Dann verfolgt die Therapie das Ziel, den Krankheitsverlauf zu kontrollieren und die Lebensqualität der Patienten zu stabilisieren oder zu verbessern.
Wenn Sie mehr wissen möchten über Lungenkrebs, empfehlen wir Ihnen als Informationsquellen den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums, die Deutsche Krebsgesellschaft und den Blauen Ratgeber Lungenkrebs der Deutschen Krebshilfe.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23
Nächste Schritte
-
Nach einer Lungenkrebsdiagnose ist Ihr behandelnder Facharzt/Ihre Fachärztin (in der Regel ein Pneumologe/eine Pneumologin mit onkologischer Erfahrung oder ein Onkologe/eine Onkologin). bei allen Fragen für Sie die wichtigste Anlaufstelle. Mit ihm/ihr können Sie Ihre Diagnose und die weitere Behandlung besprechen. Fragen Sie so lange nach, bis Sie wirklich alles verstanden haben.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob die vorgeschlagene Behandlung die richtige ist, sollten Sie Ihre Zweifel offen ansprechen. Bleiben die Zweifel bestehen, haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen Ihres Rechts auf freie Arztwahl eine Zweitmeinung einzuholen.
Dazu sollten Sie sich beispielsweise an ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum oder ein anderes spezialisiertes onkologisches Zentrum wenden, in dem Fachleute aus viele verschiedenen Disziplinen unter einem Dach arbeiten.
Hilfe bei der Facharztsuche bietet der Bundesverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V. (BNHO). Der Verband bietet im Internet eine Suchfunktion, über die man niedergelassene Fachärzte in der persönlichen Umgebung finden kann.
Eine weitere Übersicht und Hilfe für die Arztsuche finden Sie beim Nationalen Netzwerk für genomische Medizin Lungenkrebs (nMGM).
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23 -
Bei einer Lungenkrebsbehandlung werden in der Regel verschiedene Behandlungsmöglichkeiten kombiniert, z. B. Medikamente, Bestrahlung und Operation. Deshalb sind neben der Hausarztpraxis viele verschiedene Spezialist:innen an der Lungenkrebsbehandlung beteiligt (z. B. aus der Onkologie, Pneumologie, Radiologie, Palliativmedizin, Schmerztherapie, Psychoonkologie).
Im Verlauf der Therapie werden Sie mit verschiedenen Spezialist:innen zusammenkommen, die jeweils für einen Teil der Behandlung zuständig sind. Wegen der komplexen Behandlung ist ein:e Therapiekoordinator:in extrem wichtig, der/die den Überblick behält. Dies ist in der Regel nicht die Hausarztpraxis, sondern z. B. ein Lungenarzt/eine Lungenärztin (Pneumologe/Pneumologin mit onkologischer Erfahrung) oder ein Krebsmediziner/eine Krebsmedizinerin (Onkologe/Onkologin) in einem Krankenhaus.
Hilfe bei der Facharztsuche bietet der Bundesverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V. (BNHO). Der Verband bietet im Internet eine Suchfunktion, über die man niedergelassene Fachärzte in der persönlichen Umgebung finden kann.
Wenn Sie kurzfristig einen Termin bei einem Facharzt vereinbaren möchten, können Ihnen möglicherweise auch die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) weiterhelfen.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 21.08.25 -
In spezialisierten onkologischen Zentren arbeiten verschiedene Fachärzt:innen und weitere Spezialist:innen gemeinsam unter einem Dach. Diese Zentren befinden sich meist in großen Krankenhäusern oder Universitätskliniken und sind auf die Therapie von Lungenkrebs spezialisiert. Deshalb können diese Zentren eine intensivere und komplexere Betreuung und Versorgung von Lungenkrebspatienten bieten als ein „normales“ Krankenhaus. Zudem trägt die hohe Zahl der Behandlungen von Menschen, die an der gleichen Erkrankung leiden, zur Qualität der Versorgung bei.
Was außerdem für eine Behandlung im Zentrum spricht: Die behandelnden Ärzt:innen sind auf dem neuesten Stand, was angesichts der schnellen Entwicklung im Bereich der Krebsmedizin besonders wichtig ist.
In den Zentren werden individuelle Therapiepläne in regelmäßigen „Tumorkonferenzen“ entwickelt. Bei solchen Konferenzen (auch „Tumorboards“ genannt) werden der Gesundheitszustand, die Krankheitseigenschaften und die Therapiemöglichkeiten der Patienten diskutiert und entsprechende Behandlungspläne erstellt. Zusätzlich gibt es in der Regel eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Krebsärzten, Selbsthilfegruppen und mit Psychologen, die auf die Betreuung von Krebspatienten spezialisiert sind.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 15.12.23