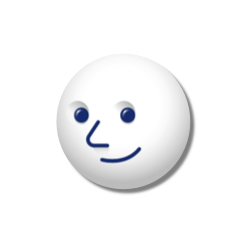Rat und Hilfe
-
Erkrankt jemand an Lungenkrebs, betrifft das immer auch die Angehörigen. Viele möchten helfen und eine wichtige Stütze sein, machen sich aber anderseits Sorgen oder können die neue Lebenssituation selber nicht gut bewältigen. Es ist nicht immer leicht, die nötige Stärke aufzubringen und den Betroffenen bestmöglich zu helfen.
Verschiedene Stellen bieten Rat und Hilfe für Angehörige. Beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums oder bei der Deutschen Krebsgesellschaft erfahren Sie, wie Sie Menschen mit Krebs unterstützen können, ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren. Die Deutsche Krebshilfe hat einen Ratgeber mit Hilfen für Angehörige herausgegeben.
Sie können sich auch an eine Selbsthilfeorganisation wenden oder sich in Internetforen mit anderen Angehörigen über Ihre Erfahrungen austauschen.
Die Angehörigen von zielgerichtet behandelten Patientinnen und Patienten mit genomisch bedingtem Lungenkrebs finden Unterstützung beim Patientennetzwerk ZielGENau e.V. Eine weitere gute Anlaufstelle für Angehörige von Menschen mit ALK-positivem Lungenkrebs ist das Patientennetzwerk ALK-Positiv Deutschland.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 29.07.24
Partnerschaft/Familie
-
Die Krebsdiagnose bringt vieles durcheinander. Neben den körperlichen Folgen einer Behandlung, ist die psychische Belastung für Patient:innen enorm. Es ist ganz normal, dass jemand sich dadurch verändert.
Im Angesicht einer Krebserkrankung wird das äußere Leben neu arrangiert. Manche Menschen finden plötzlich eine ganz andere Seite an sich und verändern auch ihre inneren Werte. Sie ziehen sich zurück oder beginnen Dinge zu tun, die sie schon immer tun wollten und stets verdrängt haben. Für die Angehörigen kann so eine Wesensänderung fremd und belastend wirken. Die Wandlung kann aber auch nur vorübergehend sein. Sie sollten offen darüber sprechen und nach einer Möglichkeit suchen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Eine Partnerschaft kann den Belastungen standhalten und an ihnen wachsen.
Sie können sich professionelle Hilfe bei Psychoonkolog:innen oder Therapeut:innen holen, die bereits viele andere Betroffene und Paare begleitet haben. Weitere Informationen zu psychologischer Unterstützung finden Sie auch in der Rubrik "Unterstützung".
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Häufig kommt es vor, dass sich Patient:innen nicht mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen wollen. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. So ist es bei manchen die Angst vor dem, was kommen mag, andere fühlen sich überfordert und geben gerne die Verantwortung an den Arzt ab und wollen sich nicht selbst kümmern.
Wenn Sie in dieser Situation dann gutgemeinte Vorschläge machen, was vielleicht noch zusätzlich getan werden könnte, kann es zu Streitereien kommen. In bestimmten Phasen kann Abwehr als unbewusste Form der Bewältigung den Patient:innen seelische Entlastung bieten. Wie Betroffene die Krankheit Krebs verarbeiten, ist immer individuell. Es gibt keinen „richtigen“ oder „falschen“ Weg, mit der Erkrankung umzugehen.
Geben Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin Zeit. Für Angehörige kann es hilfreich sein, sich zu informieren. Dann haben Sie im Falle des Falles alle Hintergrundinformationen parat.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Möglicherweise möchte Ihr:e Partner:in Sie nicht belasten oder sich momentan einfach nicht mit der Lungenkrebserkrankung befassen. Es kann auch vorkommen, dass Menschen sich nach einer Krebsdiagnose zunächst erst selbst mit der Krankheit auseinandersetzen, bevor sie mit anderen reden.
In bestimmten Phasen kann Stille seelische Entlastung bieten. Es kann hilfreich sein, ein vorübergehendes Schweigen zu respektieren. Bieten Sie dann wieder behutsame Gespräche an und zeigen Sie, dass Ihr:e Partner:in solche Gedanken mit Ihnen teilen kann. Nicht immer muss sich alles ausschließlich um die Krebserkrankung drehen. Manchen Betroffenen kann es Kraft geben, über gute gesunde Zeiten zu reden.
Wenn Sie das Bedürfnis haben, über die Erkrankung zu sprechen, könnte auch der Austausch mit anderen förderlich sein. In Selbsthilfegruppen sind meist nicht nur Patient:innen, sondern auch Angehörige engagiert, die ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen können. Oft ist auch ein Gespräch mit einem/einer (Paar-)Therapeut:in oder die Einbeziehung eines vertrauten Menschen als Vermittler:in hilfreich.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 29.07.24 -
Die Symptome der Erkrankung, die Strapazen der Operation, die Nebenwirkungen der Therapie oder die emotionalen Belastungen können dazu führen, dass die Lust auf Sexualität (zeitweise) vergeht. Vielleicht beruhigt es Sie zu wissen, dass es vielen anderen Menschen in dieser Situation genauso geht. Helfen kann ein offenes Gespräch über Ihre sexuellen Empfindungen. Für viele Paare kann ein unerklärtes Schweigen zur Belastung werden.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Unterstützung von außen angebracht wäre, können Sie therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Adressdatenbanken finden Sie beim Krebsinformationsdienst oder bei der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie.
Lesen Sie hier mehr über das Thema Sexualität nach einer Krebserkrankung. Außerdem empfehlen wir Ihnen den Ratgeber „Männliche Sexualität und Krebs“ und „Weibliche Sexualität und Krebs" des Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Eine Krebstherapie kann die Zeugungsfähigkeit und Fertilität der Patient:innen beeinträchtigen. Wenn das Thema Familienplanung für Sie wichtig ist, sollten Sie sich dazu vor dem Start der Therapie gründlich informieren. Fragen Sie den behandelnden Arzt / die Ärztin, welche Risiken bestehen und was Patient:innen tun können, um ihre Zeugungsfähigkeit und Fertilität zu erhalten.
Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik „Leben mit der Erkrankung“.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Ihr Kind mit der neuen Situation nicht zurechtkommt, ist es wichtig, sich frühzeitig Unterstützung von außen zu suchen. Fragen Sie den behandelnden Arzt/die Ärztin oder andere Beratungsstellen (Schule, Sozialpädiatrisches Zentrum, Suchtberatung etc.), wo Sie Unterstützung bekommen, ggf. auch eine psychotherapeutische Begleitung. Wertvolle Ratschläge, was Kindern krebskranker Eltern hilft, finden Sie auf der Website der Deutschen Krebsgesellschaft.
Vielerorts bieten psychosoziale Krebsberatungsstellen eine spezielle Beratung krebsbetroffener Eltern zum Umgang mit ihren Kindern an. Adressen regionaler Krebsberatungsstellen können Sie dem Verzeichnis des Krebsinformationsdienstes entnehmen.
Außerdem hat der Verein Hilfe für Kinder krebskranker Eltern e.V. Infos und Ansprechpartner für Erwachsene und ihre Kinder zusammengetragen. Eltern und Kinder können sich auch an Flüsterpost e.V. wenden.
Ein weiteres Angebot für Familien. Die Initiative "Familienhörbuch" bietet unheilbar erkrankten Menschen die Möglichkeit, ihre persönliche Lebensgeschichte als professionell aufgenommenes Audio-Dokument für Kinder und Enkel zu bewahren.
Schauen Sie auch in der Rubrik „Unterstützung/Psychologische Unterstützung“ vorbei.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23
Umgang mit Angst
-
Es ist ganz normal, dass die Diagnose Lungenkrebs auch in Ihnen Angst auslöst. Abhängig von der jeweiligen Lebenssituation oder dem Stadium der Erkrankung kann das beispielsweise die Angst um Ihren Partner/Ihre Partnerin oder auch Angst vor Veränderungen, Überforderung und Verlust sein.
Wichtig ist, dass Sie Ihre Ängste zulassen, offen darüber sprechen und nichts in sich hineinfressen. Auch weinen kann zur Bewältigung einer solchen Situation gehören. Haben Sie Freunde, mit denen Sie sich austauschen können? Es kann auch hilfreich sein, sich Beistand bei Selbsthilfegruppen zu suchen oder sich in Internetforen mit anderen Betroffenen auszutauschen. Auch viele Krankenkassen bieten psychologische Unterstützung über Telefon oder Internet an.
Auch in psychosozialen Krebsberatungsstellen finden Sie Unterstützung. Adressen regionaler Anlaufstellen finden Sie hier.
Weitere Informationen zu einer psychologischen Unterstützung finden Sie auch in der Rubrik „Unterstützung" beim Thema „Psychologische Unterstützung".
Die Angehörigen von zielgerichtet behandelten Patientinnen und Patienten mit genomisch bedingtem Lungenkrebs finden Unterstützung beim Patientennetzwerk ZielGENau e.V. Eine weitere gute Anlaufstelle für Angehörige von Menschen mit ALK-positivem Lungenkrebs ist das Patientennetzwerk ALK-Positiv Deutschland.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.08.25 -
Es passiert häufig, dass Patient:innen von Ängsten überwältigt werden – vor den Schmerzen, den Folgen der Therapie, dem Verlust der Autonomie und vor dem Tod. In jedem Fall ist es hilfreich, wenn Sie sich umfassend über die Erkrankung informieren. Wenn Sie über Lungenkrebs, die unterschiedlichen Therapieoptionen, Chancen und Risiken faktisch Bescheid wissen, können Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin besser helfen, sich seelisch zu stabilisieren. Mit diesem Wissen können Sie ihn/sie zu wichtigen Untersuchungen begleiten. Im gemeinsamen Gespräch mit dem medizinischen Personal können Sie bei Unklarheiten nachfragen. Fragen Sie, ob die Ängste begründet sind und welche konkreten Möglichkeiten es gibt. um z.B. Schmerzen zu behandeln.
Weitere Informationen zu einer palliativen Behandlung können Sie in der Rubrik "Behandlung/Palliative Behandlung" nachlesen.
Wenn Angstgefühle zu einer großen Belastung werden, können Sie auch eine psychoonkologische Beratung in Anspruch nehmen.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 29.07.24
Hilfe im Alltag
-
Es ist normal, dass eine Lungenkrebserkrankung sämtliche Familienmitglieder belastet. Krebs bedeutet einen tiefen Einschnitt in das bisherige Leben. ein Wunder, dass Patient:innen und ihre Familien infolge der Erkrankung auch mit einem Gefühlschaos von Angst, Wut, Resignation, Mut und Hoffnung zu kämpfen haben.
Sie können sich Unterstützung für die praktischen Dinge im Alltag holen, z. B. Haushaltshilfe, Kinderbetreuung etc. Nähere Informationen zu Hilfen finden Sie in der Rubrik "Unterstützung" beim Thema „Sozialrecht".
Eine Krebserkrankung kann eine Beziehung auf eine harte Probe stellen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie eher ein Problem damit haben, offen und ehrlich zu reden, kann eine psychologische Beratung helfen.
Weitere Informationen zu einer psychologischen Unterstützung finden Sie auch in der Rubrik „Unterstützung" beim Thema „Psychologische Unterstützung".
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Es tut Ihrem Partner / Ihrer Partnerin sicher gut, sich intensiv mit seiner/ihrer Lungenkrebserkrankung zu befassen.
Möglicherweise würde es ihm/ihr aber auch bei der Krankheitsverarbeitung guttun, mit Ihnen etwas Schönes zu unternehmen, um auf andere Gedanken zu kommen und die guten Seiten des Lebens zu erfahren. Versuchen Sie, regelmäßig Zeit und Raum für gemeinsame positive Erlebnisse einzuräumen. Sie können von der augenblicklichen Last befreien. Sprechen Sie Ihre:n Partner:in darauf an und machen Sie konkrete Vorschläge.
Wenn das nicht hilft, holen Sie sich Unterstützung von Therapeut:innen, die sich damit auskennen und schon viele Paare in diesem Prozess begleitet haben.
Weitere Informationen zu den Möglichkeiten einer psychologischen Unterstützung finden Sie auch in der Rubrik „Unterstützung" beim Thema „Psychologische Unterstützung".
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Wenn jemand an Krebs erkrankt ist, müssen Angehörige oft eine Vielzahl an organisatorischen und praktischen Dinge bewerkstelligen. Wenn Sie das Gefühl haben, der Situation nicht mehr gewachsen zu sein, kann Unterstützung im Alltag entlasten.
Welche Leistungen Krebspatient:innen konkret bekommen können, hängt dabei ganz vom individuellen Fall der Bedürftigkeit ab. Für eine erste Orientierung kann man sich im Krankenhaus an den Sozialmedizinischen Dienst wenden.
Sie können auch eine der Krebsberatungsstellen, die es vielerorts in Deutschland gibt, oder die Sozialverbände (VdK oder Sozialverband Deutschland) kontaktieren. Am besten fragen Sie nach einem Ortsverband in Ihrer Nähe. Dort können Sie sich informieren, welcher Leistungsanspruch bei Krankenkassen, Rentenversicherung oder der Agentur für Arbeit besteht.
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über wichtige finanzielle und rechtliche Fragen. Oder informieren Sie sich in der Rubrik Unterstützung weiter zum Thema „Sozialrecht“.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 29.07.24
Arbeit & Finanzen
-
Viele Krebspatient:innen erleben die Rückkehr in das Arbeitsleben als Motivation und Stärkung des Selbstbewusstseins. Ob es sinnvoll ist, weiter zu arbeiten, hängt sowohl von der Art der Berufstätigkeit als auch von den sonstigen Lebensumständen ab.
Metastasierter Lungenkrebs kann zur Einschränkung der Lungenfunktion führen, was vor allem bei körperlicher Arbeit zu spüren ist. Ist Ihr:e Partner:in nicht mehr so belastbar, kann mit dem Vorgesetzten besprochen werden, ob innerhalb des Arbeitsumfelds eine andere Position infrage kommt, deren Anforderungen leichter zu bewältigen sind.
Wer an einen Wiedereinstieg in den Beruf denkt, sollte durch die Behandlung nicht zu stark belastet oder einschränkt werden. Außerdem sollte der behandelnde Arzt/die Ärztin den geplanten Wiedereinstieg in das Berufsleben befürworten.
Reden Sie offen darüber, falls sie unsicher sind, ob die Kraft Ihres Partners/Ihrer Partnerin zum Arbeiten ausreichen kann oder nicht. Schauen Sie auch in der Rubrik „Beruf und Soziales/Teilhabe am Arbeitsplatz“ vorbei.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Krankheit sollte Ihre Familie nicht arm machen! Ist Ihr:e Partner:in gesetzlich versichert und krankgeschrieben, dann zahlt der Arbeitgeber in der Regel zunächst 6 Wochen lang Lohn bzw. Gehalt weiter. Danach springt die Krankenkasse ein. Diese zahlt bis zu 78 Wochen pro Krankheitsfall. Nach 6 Wochen Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber sind es längstens 72 Wochen. Bei Fragen bezüglich des Krankengeldes hilft die Krankenkasse weiter.
Dauert die Krankheit länger als 78 Wochen an, kann unter bestimmten Voraussetzungen die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung finanziell entlasten. Die Nahtlosigkeitsregelung soll eine mögliche zeitliche Lücke zwischen dem Anspruch auf Krankengeld und beispielsweise einer späteren eventuellen Arbeitsaufnahme oder einem geplanten Rentenbeginn schließen. Für diesen Zeitraum kann Arbeitslosengeld I beantragt werden. Im Fall einer längeren Krankheit kommt eine Erwerbsminderungsrente infrage. Hierzu müssen entsprechende Vorversicherungszeiten vorliegen. Eine individuelle Beratung bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Rentenversicherung ist dann unverzichtbar. Bei einem Klinikaufenthalt steht Ihnen der Soziale Dienst für Fragen zur Verfügung.
Weiterführende Informationen zur Erwerbsminderungsrente finden Sie auf der Website der Deutschen Rentenversicherung. Mehr zum Thema finden Sie im Blauen Ratgeber „Wegweiser zu Sozialleistungen“ der Deutschen Krebshilfe. Schauen Sie auch in der Rubrik „Beruf und Soziales/ Finanzielle Absicherung bei Krankheit" vorbei. Als Mitglied eines Sozialverbandes (z. B. VdK oder Sozialverband Deutschland) kann man auch bei Widersprüchen/Anträgen auch die Hilfe von Anwälten des VdK in Anspruch nehmen.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23
Palliative Versorgung
-
Wenn der Krebs bereits gestreut hat, ist eine Heilung in der Regel nicht möglich. Ziel der Behandlung ist es dann, die Erkrankung über möglichst lange Zeit zu kontrollieren, tumorbedingte Beschwerden zu verhindern bzw. zu lindern und die Lebensqualität zu halten oder zu verbessern. Durch die Entwicklung von neuen Therapien konnte in den letzten Jahren die Prognose in vielen Fällen deutlich verbessert werden.
In dieser Situation sollte man sich nicht durch Statistiken entmutigen lassen oder deshalb die Therapie vorzeitig beenden. Statistische Durchschnittswerte sagen nur bedingt etwas über die Lebenserwartung einzelner Patient:innen aus. Es gibt immer wieder Verläufe, die ganz anders sind als alle Beispiele aus der Fachliteratur. Am ehesten können die behandelnden Ärzt:innen etwas zur Prognose sagen. Sie kennen die Befunde und können erklären, was sich daraus ableiten lässt.
Wenn Lungenkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium andere lebenswichtige Organe stark angreift und wichtige Körperfunktionen beeinträchtigt, können unterstützende Maßnahmen helfen, den Gesundheitszustand zu stabilisieren, Symptome zu verringern und das Leben erheblich zu verlängern. Weitere Informationen zu einer palliativen Versorgung finden Sie hier.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.12.23 -
Wenn Ihr Partner/Ihre Partnerin eine so stark fortgeschrittene Lungenkrebserkrankung hat, ist es besonders wichtig, die richtige medizinische Versorgung und die richtige Pflege zur Seite zu haben.
Den letzten Lebensabschnitt müssen Patient:innen nicht unbedingt im Krankenhaus verbringen. Gesetzlich versicherten Schwerkranken steht vielerorts das besondere Angebot der sogenannten Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) zur Verfügung. Die „Palliative-Care-Teams“ bestehen aus Ärzt:innen, Pflegenden und häufig auch Sozialarbeiter:innen. Zusammen gewährleisten sie rund um die Uhr eine gute und sichere Versorgung.
Palliativstationen im Krankenhaus können die nötige Betreuung übernehmen. Palliativmedizin hat zum Ziel, Beschwerden, die infolge der Krebserkrankung und ihrer Therapien auftreten, zu lindern. Sie unterstützt zudem bei Bedürfnissen, die über die medizinische Versorgung hinausgeht, wie beispielsweise bei sozialen oder spirituellen Fragen. Eine Liste mit Palliativstationen finden Sie hier.Wenn Sie Ihren Partner/Ihre Partnerin nicht zu Hause betreuen können oder wollen, kann auch ein Hospiz ein geeigneter Ort sein. Der Wegweiser Hospiz und Palliativmedizin Deutschland der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin unterstützt Sie und Ihren Partner bei der Suche nach Hospizen.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 21.08.25 -
Es ist wichtig, dass Partner:innen in jedem Fall, auch wenn es ganz ernst ist, füreinander da sein können. Auch wenn es Ihnen jetzt schwerfällt, darüber nachzudenken, diese drei Formulare können vieles vereinfachen und schaffen Sicherheit, falls Ihr:e Partner:in aufgrund einer Erkrankung nicht mehr selbst entscheiden und sich äußern kann. Auch für Sie kann es eine Erleichterung sein, wenn Sie seine/ihre Wünsche kennen und respektieren können.
Weiterführende Informationen und Vordrucke zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsrecht finden Sie beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz oder auch bei Sozialverbänden und kirchlichen Organisationen.
Wenn Sie sich näher mit dem Thema Vorsorge beschäftigen wollen, empfehlen wir Ihnen das Buch „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung" der Verbraucherzentrale.
Mehr Informationen finden Sie auch in der Rubrik „Leben mit der Erkrankung/ Vorsorge treffen“.
Verfasst von der HILFEFÜRMICH-Redaktion und aktualisiert am 18.08.25